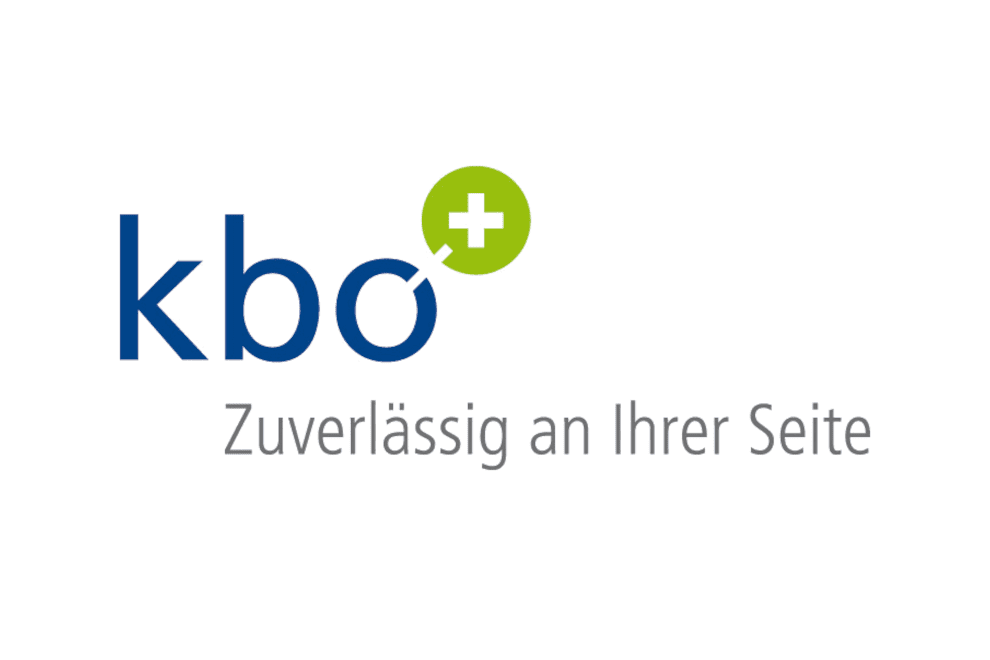INterCuLtUral Child DevelopmEnt (INCLUDE): Kultur- und traumasensitive Versorgung von Kindern aus Familien mit Fluchterfahrung
Belastende Kindheitserlebnisse haben in vielen Fällen schwerwiegende Folgen für das Wohlbefinden und auf den Gesundheitszustand bis in das Erwachsenenalter hinein. Auch junge Kinder können von Traumafolgestörungen betroffen sein. Im Hinblick auf die Versorgung unserer jungen Patienten ist dies aktuell hoch relevant, da mit den Familien mit Fluchthintergrund eine diesbezüglich sehr vulnerable Patientengruppe zunehmend häufiger in unserem Behandlungssystem Hilfe sucht.
INCLUDE (PDF)
Aktuell leben knapp 3 Millionen schutzsuchende Menschen in Deutschland, wobei ca. ein Viertel der Asylanträge in den letzten Jahren für Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren gestellt wurden.1
Seit 2016 bietet unsere Projektgruppe mit der über das Bayrische Innenministerium geförderten Interdisziplinären Sprechstunde für Kinder mit Fluchterfahrung (ISKF) eine frühzeitige und niedrigschwellige diagnostische und therapeutische Versorgung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit Fluchthintergrund direkt vor Ort in den Unterkünften (Dependancen des Ankerzentrums Manching) an. Seit November 2020 konnte die ISKF mit EU-Fördermitteln (AMIF-Fonds) erweitert und um eine kultur- und traumasensitive Komponente beim pädagogischen Kinderangebot und um niedrigschwellige Psychoedukationsgruppen für Eltern ergänzt werden (AM19-BY5232, 9168-2022-0193). Das manualisierte Gesamtkonzept wurde im Hogrefe Verlag veröffentlicht (Kinder mit Fluchterfahrung optimal versorgen | Hogrefe) und ist als Buch erhältlich.
Die psychoedukativen Elterngruppen „Parents‘ College“ werden aktuell fortlaufend in Unterkunftsdependancen in München durchgeführt.
In den begleitend zu unserer klinischen Versorgung durchgeführten Studien unserer Arbeitsgruppe hat sich gezeigt, dass die untersuchten 3- bis 6-jährige Kinder mit Fluchterfahrung nicht nur hohe Raten an Traumafolgestörungen2 und Verhaltensauffälligkeiten im Betreuungsumfeld zeigen,3,4 sondern auch deutliche Entwicklungsrückstände hinsichtlich der schulischen Vorläuferfähigkeiten aufweisen.5 Darüber hinaus leiden die Eltern häufig selbst unter Traumafolgestörungen,4,5 was das Erkennen und den Umgang mit den Symptomen und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder zusätzlich erschwert und zur Chronifizierung der Symptome und weiteren Deprivation der Kinder beitragen kann.
Ziel unseres kultur- und traumasensitiven Ansatzes ist es daher, zeitnah zur Ankunft in Deutschland nicht nur bei den Kindern anzusetzen, sondern auch die Eltern und das Betreuungsumfeld im Sinne eines ökosystemischen Ansatzes im Behandlungskonzept zu integrieren.
Zudem arbeiten wir daran, die Diagnose-, Untersuchungs- und Therapiemethoden universell und kulturübergreifend anzupassen und zu gestalten. So hat sich in einer unserer Studien gezeigt, dass eine standardisierte Spielbeobachtung als leicht durchführbares und valides Instrument zur Einschätzung des kognitiven, sprachlichen und sozial-emotionalen Entwicklungsstandes von Kindern dienen kann.6
Die begleitende wissenschaftliche Evaluation beinhaltet längs- und querschnittliche Erhebungen bezüglich der Effekte der eingesetzten Maßnahmen auf die kindliche Gesamtentwicklung (kognitive und sozial-emotionale Entwicklung, Lernverhalten, biologisches Stresslevel).
Wie erwarten, dass sich auf diesem Weg Wirkfaktoren identifizieren lassen zur Herstellung entwicklungsförderlicherer Rahmenbedingungen in Aufnahmeeinrichtungen. Damit können auf lange Sicht über rechtzeitige Interventionen Folgeprobleme vermieden und die Integration der zugewanderten Kinder erleichtert werden.
- Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Aktuelle Zahlen. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. (Das Bundesamt in Zahlen 2022 Asyl, Migration und Integration (bamf.de)). Zugegriffen: 29.02.2024.
- Soykök, S., Mall, V., Nehring, I., Henningsen, P. & Aberl, S. (2017). Post-traumatic stress disorder in Syrian children of a German refugee camp. The lancet 389 (4). 903-904.
- Bernhardt, K., Le Beherec, S., Uppendahl, J. R., Fleischmann, M., Klosinski, M., Rivera, L. M., Samaras, G., Kenney, M., Müller, R., Nehring, I., Mall, V., & Hahnefeld, A. (2024). Young Children’s Psychological and Developmental Trajectories after Forced Displacement: A Systematic Review. European Child & Adolescent Psychiatry.
- Hahnefeld, A., Sukale, T., Weigand, E., Münch, K., Aberl, S., Eckler, L. V., Schmidt, D., Friedmann, A., Plener, P. L., Fegert, J. M., & Mall, V. (2021). Survival states as indicators of learning performance and biological stress in refugee children: a cross-sectional study with a comparison group. BMC psychiatry, 21(1), 228. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03233-y
- Hahnefeld, A., Sukale, T., Weigand, E., Dudek, V., Münch, K., Aberl, S., Eckler, L. V., Nehring, I., Friedmann, A., Plener, P. L., Fegert, J. M., & Mall, V. (2022). Non-verbal cognitive development, learning, and symptoms of PTSD in 3- to 6-year-old refugee children. European journal of pediatrics, 181(3), 1205–1212. https://doi.org/10.1007/s00431-021-04312-8
- Bernhardt, K., Le Beherec, S., Uppendahl, J., Baur, M.-A., Klosinski, M., Mall, V. & Hahnefeld, A. (2023). Exploring Mental Health and Development in Refugee Children Through Systematic Play Assessment. Child Psychiatry & Human Development. https://doi.org/10.1007/s10578-023-01584-z
- Hahnefeld A, Fink M, Le Beherec S, Baur MA, Bernhardt K, Mall V. Correlation of screen exposure to stress, learning, cognitive and language performance in children. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2024 Oct 23. doi: 10.1007/s00787-024-02593-6. Epub ahead of print. Erratum in: Eur Child Adolesc Psychiatry. 2024 Dec 9. doi: 10.1007/s00787-024-02625-1. PMID: 39443365.
Projekt- und Studienleitung: Dr. rer. nat. Andrea Hahnefeld
Kooperationspartner/-Projekte:
- Lehrstuhl für Psychosomatik (Rechts der Isar, TU München, Prof. Dr. Henningsen, Sigrid Aberl): ISKF in Aufnahmeeinrichtungen
- Universitätsklinik Ulm (Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, Prof. Dr. J. Fegert, T. Sukale): PORTA („Providing Online Ressource and Trauma Assessment for Refugees“)
- Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München (Prof. Dr. E. Binder): Epigenetische Analysen
Team: Marie Baur, Saskia Le Beherec, Katharina Bernhardt, Verena Dudek, Lea Eckler, Monika Fink, Melia Fleischmann, Elena Hauber, Klara Karali, Matthias Klosinski, Katharina Münch, Leonie Pattard, Lena Streckert, Penelope Thomas, Jana Uppendahl, Elena Weigand
Ansprechpartnerin/Projektleitung: Dr. rer. nat. Andrea Hahnefeld
Psychologische Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie) mit Weiterbildung „Spezielle Psychotraumatherapie mit Kindern und Jugendlichen“ (DeGPT)
Tel.: 089 71009 1931
Email: andrea.hahnefeld(at)kbo.de